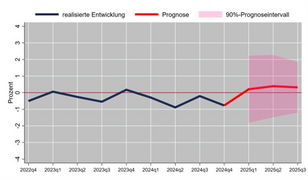Bundesbank-IAW-Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion im Haus der Wirtschaft, Stuttgart
› AußenwirtschaftVerleihung des Norbert-Kloten-Preises für Angewandte Wirtschaftsforschung 2025 an:
Herrn Jan Jacobsen, M.Sc. für seine Masterarbeit Do Finfluencers Give Good Investment Advice? A large-scale, LLMpowered Analysis of the Profitability of Investment Recommendations on YouTube. Betreuer: Professor Dr. Dominik Papies, Lehrstuhl für Marketing, an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen.

Foto: Deutsche Bundesbank
V.l.n.r.: Prof. Dr. Martin Biewen, Direktor des IAW, Jan Jacobsen und Dr. Patricia Staab, Präsidentin der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Baden-Württemberg.
Vortrag
Deutschland im internationalen Steuerwettbewerb.

Foto: Deutsche Bundesbank
Professor Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest (Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Präsident des ifo Instituts).
Podiumsdiskussion

Foto: Deutsche Bundesbank
- Raoul Didier, Leiter des Referats Steuerpolitik beim DGB
- Professor Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest, Präsident des ifo Istituts
- Dr. Tobias Hentze, Leiter des Themenclusters Staat, Steuern, Soziale Sicherung des IW Köln
- Julia Jirmann, Referentin für Steuerpolitik des Netzwerks Steuergerechtigkeit
- Moderation: Johannes Pennekamp (FAZ)